Vorlesezeit: 4 min
Es war einmal eine Zeit, aber das ist schon undenklich lange her, da trugen alle Kornhalme, und auch die von anderem Getreide, volle goldgelbe Ähren herab bis auf den Boden; da gab es keine Armut und keine Hungersnot, niemals, und das war die goldene Zeit. Da konnten sich alle Menschen mit Wonne sättigen, und auch die Vögel, die gerne Körner fressen, Hühner und Tauben und andere Vögel, fanden Futter vollauf.
Aber da waren unter den Menschen welche, die waren undankbar und gottvergessen und achteten die schöne werte Gottesgabe, das liebe Getreide, für gar nichts. Da gab es Frauen, die nahmen, wenn ihre kleinen Kinder sich verunreinigt hatten, die vollen Ährenbüschel und reinigten damit ihre Kinder und warfen die Ähren auf den Mist; und die Mägde scheuerten mit den vollen Ähren, und die Buben und kleine Mädchen jagten sich durch das liebe Korn, spielten Verstecken darin, wälzten sich darauf herum und zertraten es. Das jammerte den lieben Gott, der das Getreide den Menschen zur Nahrung gegeben hatte und dem Vieh zum Futter und nicht zum Verderben, und dachte bei sich, wir wollen es anders machen und die goldne Zeit soll ein Ende haben.
Und da schuf der liebe Gott, dass hinfort jeder Halm nur eine einzige Ähre trug, einmal für die Menschen, damit sie das liebe Getreide besser schonen lernten, und einmal für die unschuldigen Tiere, damit sie doch noch ihr Futter haben sollten, wenn auch die Menschen nicht einmal die eine Ähre wert wären.
Von da an ist Hunger und Teuerung und Armut in die Welt gekommen. Nur zuweilen und selten lässt der liebe Gott da oder dort einen Wunderhalm mit vielen, vielen Ähren emporschießen und zeigt so dem Menschen, wie es einst beschaffen war um das Getreide und was Er kann. Und es geht eine alte Prophezeiung unter dem Volke, dass einmal nach langen Jahren, wenn das Engelwort sich erfüllt haben wird: Ehre sei Gott in der Höhe, Friede auf Erden und unter allen Menschen Wohlwollen, Segnung und Liebe, dass dann der Boden auch wieder von Gott erweckt werden solle, solche Halme zu tragen, die bis zur Wurzel voll Ähren sind. Unser keiner aber wird das erleben.
 Lerne Sprachen. Doppelklick auf ein Wort.Lerne Sprachen im Kontext mit Childstories.org und Deepl.com.
Lerne Sprachen. Doppelklick auf ein Wort.Lerne Sprachen im Kontext mit Childstories.org und Deepl.com.Hintergründe
Interpretationen
Analyse
Die Geschichte „Die Kornähren“ von Ludwig Bechstein beschreibt eine alte Zeit, in der die Kornhalme reichlich und bis zum Boden voll goldgelber Ähren trugen, was zu Wohlstand und Überfluss führte. In dieser „goldenen Zeit“ litten weder Menschen noch Tiere Hunger. Allerdings begannen einige Menschen, diese Fülle und Gottes Gabe als selbstverständlich zu betrachten und sogar zu missbrauchen. Frauen nutzten die Ähren beispielsweise zur Reinigung ihrer Kinder, und Kinder spielten im Korn, wobei sie es beschädigten.
Gott, betrübt über diesen Mangel an Respekt, entschied, dass jeder Halm von nun an nur noch eine einzige Ähre tragen solle, um den Menschen Dankbarkeit und Sorgfalt im Umgang mit der Gabe Gottes zu lehren. Seitdem sind Hunger und Armut in die Welt gekommen. Hin und wieder ermöglicht Gott das Erscheinen eines Wunderhalms, um den Menschen daran zu erinnern, wie es einst war und was möglich wäre.
Wenn eines Tages Frieden und Wohlwollen unter den Menschen herrschen, wird Gott die Erde wieder dazu bringen, diese reichen Halme hervorzubringen. Diese Botschaft von Hoffnung und Frieden bleibt jedoch etwas für eine ferne Zukunft, die die gegenwärtige Generation nicht mehr erleben wird.
Die Erzählung vermittelt eine moralische Lektion über Dankbarkeit, den respektvollen Umgang mit Ressourcen und die Hoffnung auf eine bessere Zukunft, in der in Harmonie und Frieden gelebt wird.
Ludwig Bechsteins Märchen „Die Kornähren“ ist ein klassisches Beispiel für eine Erzählung, die sowohl moralische als auch gesellschaftliche Themen berücksichtigt. Das Märchen schildert eine Zeit des Überflusses, in der die Kornhalme voller goldgelber Ähren waren, was für Wohlstand und Sättigung bei Mensch und Tier sorgte. Diese goldene Zeit wird jedoch durch die Undankbarkeit und respektlose Haltung der Menschen gegenüber den Gaben der Natur und Gottes beendet. Der Missbrauch des Überflusses führt dazu, dass Gott beschließt, die Menschen zu lehren, das Getreide mehr zu schätzen und respektvoller damit umzugehen.
Diese Erzählung kann auf verschiedene Arten interpretiert werden:
Moralische Lehre: Das Märchen vermittelt die Botschaft, dass Undankbarkeit und Respektlosigkeit gegenüber den natürlichen Gaben zu Verlust und Entbehrung führen können. Es ist eine Mahnung, die Geschenke der Natur zu schätzen und nicht zu verschwenden.
Gesellschaftskritik: Bechstein könnte auch auf soziale Ungerechtigkeiten und die menschliche Neigung zur Selbstverschwendung hinweisen. Die Geschichte reflektiert, wie Überfluss oft zu Nachlässigkeit und mangelndem Respekt führen kann.
Religiöser Kontext: Das Märchen hat einen starken religiösen Unterton, in dem Gott als derjenige dargestellt wird, der die Fülle der Ressourcen kontrolliert und darauf achtet, dass die Menschen diese respektieren. Die Idee, dass eine Rückkehr zu einer Zeit des Überflusses nur durch Frieden, Wohlwollen und Ehre zu Gott erreicht werden kann, spiegelt eine religiös-moralische Perspektive wider.
Natürliche Ressourcen und Nachhaltigkeit: Heutzutage könnte das Märchen auch als Plädoyer für Nachhaltigkeit und einen verantwortungsvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen gelesen werden. Der Verlust der goldenen Zeit erinnert daran, dass Übernutzung und unachtsamer Umgang mit der Natur schwerwiegende Konsequenzen haben können.
Insgesamt bietet „Die Kornähren“ eine reichhaltige Grundlage für Reflexionen über menschliches Verhalten, Respekt vor der Natur und die Bedingungen für Wohlstand und Frieden in der Welt.
Die linguistische Analyse des Märchens „Die Kornähren“ von Ludwig Bechstein kann auf verschiedene sprachliche und inhaltliche Aspekte eingehen.
Sprachliche Merkmale
Sprachstil und Wortwahl: Der Text verwendet typische Merkmale der Märchensprache, wie das klassische „Es war einmal“, das auf den Erzählcharakter und die Zeitlosigkeit des Märchens hindeutet. Die Verwendung von archaischen Begriffen und Formulierungen („das ist schon undenklich lange her“, „Gottesgabe“) trägt zur märchenhaften Atmosphäre bei.
Syntax: Der Text besteht aus langen, verschachtelten Sätzen, die für ältere literarische Texte typisch sind. Parataxe und Hypotaxe wechseln sich ab, was dem Text seine rhythmische Vielfalt verleiht.
Stilmittel
Metaphern und Symbole: Die „goldene Zeit“ symbolisiert eine Ära des Überflusses und Friedens.
Personifikation: Der liebe Gott wird aktiv handelnd dargestellt, was das Eingreifen einer höheren Macht im Märchen unterstreicht.
Kontraste: Der Gegensatz zwischen der einstigen Fülle und dem heutigen Mangel verstärkt die moralische Botschaft.
Wiederholungen: Die Wiederholung von Begriffen wie „liebe[s] Getreide“ betont Wertschätzung und Mahnung.
Inhaltliche Merkmale
Thematik: Das Märchen behandelt Themen wie Dankbarkeit, Bestrafung und göttliche Gerechtigkeit. Es betont die Notwendigkeit, wertvolle Ressourcen zu schätzen.
Moral und Botschaft
Die Geschichte vermittelt eine klare Moral: undankbares Verhalten und Missachtung von Gaben führen zu Verlust und Bestrafung. Der Glaube an göttliche Gerechtigkeit und Hoffnung auf Wiedergutmachung (die mögliche Rückkehr der „goldenen Zeit“) wird propagiert.
Struktur
Der Aufbau ist klassisch für Märchen: Einleitung mit einer Beschreibung der goldenen Zeit, gefolgt von einem Fehlverhalten der Menschen, das zu einer göttlichen Intervention und einer darauffolgenden Strafe führt.
Prophezeiung als Hoffnung: Die Erzählung endet mit einer Prophezeiung, die Hoffnung auf eine bessere Zukunft lässt, jedoch gleichzeitig die Unwahrscheinlichkeit ihrer eigenen Erfüllung betont.
Kultureller und Historischer Kontext
– Bechsteins Märchen spiegeln oft moralische und gesellschaftliche Ansichten des 19. Jahrhunderts wider, als Frömmigkeit, Disziplin und Demut geschätzt wurden. Der Text kann als Kritik an der Verschwendung und Undankbarkeit der Menschen gelesen werden, die zu Bechsteins Zeit möglicherweise ein relevantes Thema war.
Diese Analyse zeigt, wie Bechstein sprachliche Mittel einsetzt, um eine tiefgründige und lehrreiche Geschichte zu erzählen, die sowohl zur Unterhaltung als auch zur moralischen Unterweisung dient.
Informationen für wissenschaftliche Analysen
Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Lesbarkeitsindex nach Amstad | 55 |
| Lesbarkeitsindex nach Björnsson | 52.6 |
| Flesch-Reading-Ease Index | 41.5 |
| Flesch–Kincaid Grade-Level | 12 |
| Gunning Fog Index | 16.4 |
| Coleman–Liau Index | 12 |
| SMOG Index | 12 |
| Automated Readability Index | 12 |
| Zeichen-Anzahl | 2.123 |
| Anzahl der Buchstaben | 1.705 |
| Anzahl der Sätze | 10 |
| Wortanzahl | 358 |
| Durchschnittliche Wörter pro Satz | 35,80 |
| Wörter mit mehr als 6 Buchstaben | 60 |
| Prozentualer Anteil von langen Wörtern | 16.8% |
| Silben gesamt | 546 |
| Durchschnittliche Silben pro Wort | 1,53 |
| Wörter mit drei Silben | 31 |
| Prozentualer Anteil von Wörtern mit drei Silben | 8.7% |
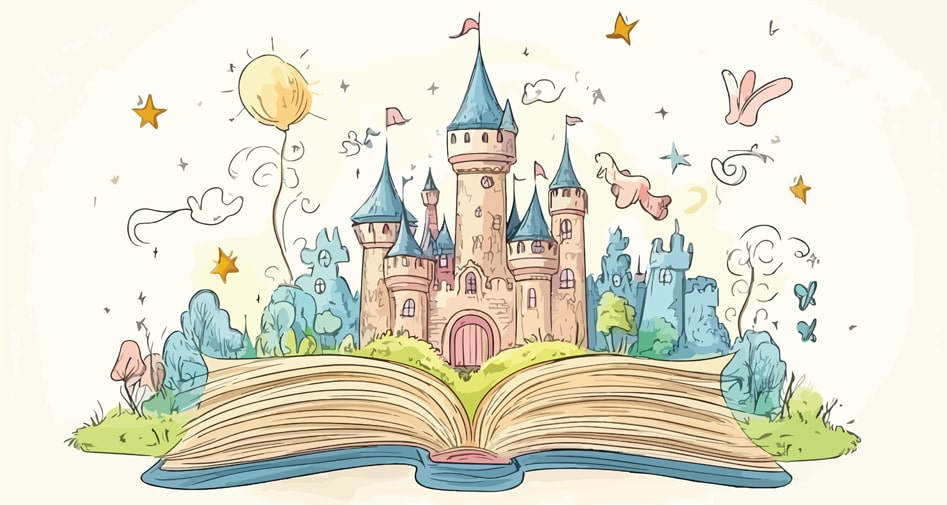
 Facebook
Facebook  Whatsapp
Whatsapp  Messenger
Messenger  Telegram
Telegram














