Vorlesezeit: 9 min
Als unser lieber Herr und Heiland noch auf Erden wandelte, von einer Stadt zur andern, das Evangelium predigte und viele Zeichen tat, kam zu ihm auf eine Zeit ein guter einfältiger Schwab und fragte ihn: »Mein Leiden-Gesell, wo willst du hin?«
Da antwortete ihm unser Herrgott: »Ich ziehe um und mache die Leute selig.«
So sagte der Schwab: »Willst du mich mit dir lassen?«
»Ja«, antwortete unser Herrgott, »wenn du fromm sein willst und weidlich beten.«
Das sagte der Schwab zu. Als sie nun miteinander gingen, kamen sie zwischen zwei Dörfer, darinnen läutete man. Der Schwab, der gern schwätzte, fragte unsern Herrgott: »Mein Leiden-Gesell, was läutet man da?«
Unser Heiland, dem alle Dinge wissend waren, antwortete: »In dem einen Dorfe läutet man zu einer Hochzeit, in dem andern zum Begängnis eines Toten.«
»Gang du zum Toten!« sprach der Schwab, »so will ich zur Hochzeit gehen.«
Darauf ging unser Herrgott in das Dorf und machte den Toten wieder lebendig, da schenkte man ihm hundert Gulden. Der Schwab tat sich auf der Hochzeit um, half einschenken, einem Gast um den andern und auch sich selbst, und als die Hochzeit zu Ende war, da schenkte man ihm einen Kreuzer. Das war der Schwab wohl zufrieden, machte sich auf den Weg und kam wieder zu unserm Herrgott.
Alsbald, wie der Schwab diesen von weitem sah, hub er sein Kreuzerlein in die Höhe und schrie: »Lug, mein Leiden-Gesell! Ich hab Geld; was hast denn du?« Trieb also viel Prahlens mit seinem Kreuzerlein.
Unser Herrgott lachet seiner und sprach: »Ach, ich hab wohl mehr als du!« tat den Sack auf und ließ den Schwaben die hundert Gulden sehen.
Der aber war nicht unbehänd, warf geschwind sein armes Kreuzerlein unter die hundert Gulden und rief: »Gemein, gemein! Wir wollen alles gemein miteinander haben!« Das ließ unser Herrgott gut sein.
Nun als sie weiter miteinander gingen, begab es sich, dass sie zu einer Herde Schafe kamen, da sagte unser Herrgott zum Schwaben: »Gehe, Schwab, zu dem Hirten, heiße ihn uns ein Lämmlein zu geben, und koche uns das Gehänge oder Geräusch zu einem Mahle.«
»Ja!« sagte der Schwab, tat, wie ihm der Herr geheißen, ging zum Hirten, ließ sich ein Lämmlein geben, zog’s ab und bereitete das Gehänge zum Essen. Und im Sieden da schwamm das Leberlein stets empor; der Schwab drückt’s mit dem Löffel unter, aber es wollte nicht unten bleiben, das verdross den Schwaben über alle Maßen. Nahm deshalb ein Messer, schnitt das Leberlein, dieweil es gar war, voneinander und aß es. Und als nun das Essen auf den Tisch kam, da fragte unser Herrgott, wo denn das Leberlein hingekommen wäre? Der Schwab aber war gleich mit der Antwort bei der Hand, das Lämmlein habe keines gehabt.
»Ei!« sagte unser Herrgott, »wie wollte es denn gelebt haben, ohne ein Leberlein?«
Da verschwur sich der Schwab hoch und teuer: »Es hat bei Gott und allen Gottes-Heiligen keines gehabt!« Was wollte unser Herrgott tun? Wollte er haben, dass der Schwab still schwieg, musste er wohl zufrieden sein.
Nun begab es sich, dass sie wiederum miteinander spazierten, und da läutete es abermals in zwei Dörfern. Der Schwab fragte: »Lieber, was läutet man da?«
»In dem Dorf läutet man zu einem Toten, in dem andern zur Hochzeit«, sagte unser Herrgott.
»Wohl!« sprach der Schwab. »Jetzt gang du zur Hochzeit, so will ich zum Toten!« (Vermeinte, er wolle auch hundert Gulden verdienen). Fragte den Herrn weiter: »Lieber, wie hast du getan, dass du den Toten auferwecket hast?«
»Ja«, antwortete der Herr, »ich sprach zu ihm, steh auf im Namen des Vaters, Sohnes und Heiligen Geistes! Da stand er auf.«
»Schon gut, schon gut!« rief der Schwab, »nun weiß ich’s wohl zu tun!« und zog zum Dorfe, wo man ihm den Toten entgegentrug. Als der Schwab das sah, rief er mit heller Stimme: »Halt da! Halt da! Ich will ihn lebendig machen, und wenn ich ihn nicht lebendig mache, so henkt mich ohne Urteil und Recht.«
Die guten Leute waren froh, verhießen dem Schwaben hundert Gulden und setzten die Bahre, darauf der Tote lag, nieder. Der Schwab tat den Sarg auf und fing an zu sprechen: »Steh auf im Namen der Heiligen Dreifaltigkeit!« Der Tote aber wollte nicht aufstehen. Dem Schwaben ward angst, er sprach seinen Segen zum andern und zum dritten Mal, als aber jener Tote sich nicht erhob, so rief er voll Zorn: »Ei so bleib liegen in tausend Teufel Namen!« Als die Leute diese gottlose Rede hörten und sahen, dass sie von dem Gecken betrogen waren, ließen sie den Sarg stehen, fassten den Schwaben und eilten demnächst mit ihm dem Galgen zu, warfen die Leiter an und führten den Schwaben hinauf.
Unser Herrgott zog fein gemachsam seine Straße heran, da er wohl wusste, wie es dem Schwaben ergehen werde, wollte doch sehen, wie er sich stellen würde, kam nun zum Gericht und rief: »O guter Gesell, was hast du doch getan? In welcher Gestalt erblick ich dich?« Der Schwab war blitzwild und begann zu schelten, der Herr hätte ihn den Segen nicht recht gelehrt. »Ich habe dich recht belehrt«, sprach der Herr. »Du aber hast es nicht recht gelernt und getan, doch dem sei, wie ihm wolle. Willst du mir sagen, wo das Leberlein hinkommen ist, so will ich dich erledigen!«
»Ach!« sagte der Schwab, »das Lämmlein hat wahrlich kein Leberlein gehabt! Wes zeihest du mich?«
»Ei, du willst’s nur nicht sagen!« sprach der Herr. »Wohlan, bekenn es, so will ich den Toten lebendig machen!«
Der Schwab aber fing an zu schreien: »Henket mich, henket mich! So komm ich der Marter ab. Der will mich zwingen mit dem Leberlein und hört doch wohl, dass das Lämmlein kein Leberlein gehabt hat! Henket mich nur stracks und flugs!«
Wie solches unser Herrgott hörte, dass sich der Schwab eher wollt henken lassen, als die Wahrheit gestehen, befahl er, ihn herabzulassen, und machte nun selbst den Toten lebendig.
Als sie nun miteinander wieder von dannen zogen, sprach unser Herrgott zum Schwaben: »Komm her, wir wollen mit einander das gewonnene Geld teilen und dann voneinander scheiden, denn wenn ich dich allewege und überall sollte vom Galgen erledigen, würde mir das zuviel.« Nahm also die zweihundert Gulden und teilte sie in drei Teile.
Als solches der Schwab sah, fragte er: »Ei, Lieber, warum machst du drei Teile, so doch unsrer nur zween sind?«
»Ja«, antwortete unser lieber Herrgott, »der eine Teil, der ist mein; der andere Teil, der ist dein, und der dritte Teil, der ist dessen, der das Leberlein gefressen hat!«
Als der Schwab solches hörte, rief er fröhlich aus: »So hab ich’s bei Gott und allen lieben Gottes-Heiligen doch gefressen!« Sprach’s und strich auch den dritten Teil ein und nahm also Urlaub von unserm lieben Herrgott.
 Lerne Sprachen. Doppelklick auf ein Wort.Lerne Sprachen im Kontext mit Childstories.org und Deepl.com.
Lerne Sprachen. Doppelklick auf ein Wort.Lerne Sprachen im Kontext mit Childstories.org und Deepl.com.Hintergründe
Interpretationen
Analyse
„Vom Schwaben, der das Leberlein gefressen“ ist ein skurriles und humorvolles Märchen von Ludwig Bechstein, das Teil von dessen Sammlung „Deutsches Märchenbuch“ ist. Wie viele andere volkstümliche Märchen aus dieser Zeit, verbindet es Moralvorstellungen, Glaubensmotive und komödiantische Elemente zu einer lehrreichen Erzählung.
Das Märchen spielt in einer Zeit, in der der christliche Glaube und biblische Erzählungen tief im gesellschaftlichen Bewusstsein verankert waren. Die Figur des Herrgotts spiegelt die allwissende und gütige Präsenz wider, während der einfältige Schwabe symbolisch für den naiven und teilweise unehrlichen Gläubigen steht.
Moral und Wahrheit: Ein zentrales Thema des Märchens ist die Wahrheit und Ehrlichkeit. Trotz mehrfacher Aufforderung lügt der Schwabe hinsichtlich des Leberleins. Die Erzählung hebt die Wichtigkeit von Ehrlichkeit hervor und zeigt die Konsequenzen von Lügen auf komödiantische Weise.
Menschliche Schwächen: Der Schwabe zeigt durch seine Handlungen menschliche Schwächen wie Gier, Lüge und Dummheit. Dennoch erhält er am Ende seine verdiente Strafe nicht durch eine göttliche, sondern eine menschliche Intervention. Dies reflektiert die Vorstellung, dass menschliche Schwächen und Fehler natürlicher Bestandteil des Charakters sind, die oft humorvoll dageboten werden können.
Humor und Ironie: Das Märchen setzt stark auf ironische Wendungen und humorvolle Darstellungen von Situationen, etwa wenn der Schwabe die Worte des Herrgotts nachplappert, aber dennoch scheitert. Diese humorvollen Elemente machen die Geschichte leichtfüßig, während sie dennoch kritisch über menschliches Verhalten reflektiert.
Symbolik des Teilens: Der Schluss der Geschichte, in der der Herrgott das Geld teilt, spricht zur Idee von Teilen und Gerechtigkeit. Der Humor siegt letztendlich, als der Schwabe, durch seine übereifrige Freude über das Geständnis, erkennt, dass die Ehrlichkeit — wenn auch durch Zufall zustande gekommen — ihm letztlich doch zum Vorteil gereicht.
Insgesamt ist das Märchen eine Mischform aus Belehrung und Unterhaltung, in der menschliche Makel mit einem Augenzwinkern betrachtet werden. Bechstein, wie auch die Brüder Grimm, sammelten und bearbeiteten solche Erzählliteratur in einer Weise, die sie für das Publikum ihrer Zeit verständlich und genussvoll machte, wobei überzeitliche menschliche Verhaltensweisen im Fokus stehen.
Das Märchen „Vom Schwaben, der das Leberlein gefressen“ von Ludwig Bechstein erzählt die Geschichte eines einfältigen Schwaben, der sich unserem Herrn und Heiland, als er noch auf Erden wandelte, anschließt. Der Schwabe, ein treuer und etwas einfältiger Begleiter, zeigt eine gewisse Naivität und Selbstüberschätzung, die zu einer Reihe von komischen und lehrreichen Situationen führt.
Die Geschichte zeigt verschiedene Facetten und moralische Lektionen:
Einfalt und Stolz: Der Schwab ist stolz auf seine kleinen Erfolge, wie das Erhalten eines Kreuzers im Vergleich zu den hundert Gulden unseres Herren. Seine Neigung zum Prahlen offenbart sowohl seine Unwissenheit als auch seine kindliche Freude über kleine Gewinne.
Gier und Selbstbetrug: Der Vorfall mit dem Leberlein symbolisiert Gier und den Drang zur Selbsterhaltung. Der Schwabe isst das Leberlein, leugnet es aber vehement, selbst als es ihm wortwörtlich an den Kragen geht. Sein Leugnen wird zum Running Gag der Geschichte.
Blinder Glaube vs. Selbstüberschätzung: Der Versuch des Schwaben, den Toten wie unser Herr zu erwecken, zeigt die Unterschätzung der göttlichen Macht und das Missverständnis des Glaubens. Seine Formeln und Flüche wirken komisch, führen aber fast zur Katastrophe.
Erlösung und Einsicht: Am Höhepunkt erreicht die Spannung ihren Höhepunkt, als der Schwabe bereit ist, sich hängen zu lassen, anstatt die Wahrheit zuzugeben. Die Erzählung stellt somit die Frage der Reue und Einsicht in den Vordergrund.
Göttliche Geduld und Humor: Unser Herr zeigt Geduld und Humor im Umgang mit dem Schwaben. Am Ende wird das Problem mit dem Leberlein fast scherzhaft gelöst, indem der Schwabe schließlich zugibt, dass er es tatsächlich gegessen hat.
Die Geschichte kann als humorvolle Belehrung über die Tücken menschlicher Schwächen wie Gier, Stolz und Dummheit betrachtet werden, die durch göttliche Weisheit und Nachsicht übertroffen werden. Die moralische Lektion mag sein, Ehrlichkeit und Demut zu bewahren und die Grenzen menschlicher Fähigkeiten zu erkennen.
Die Erzählung von Ludwig Bechstein, „Vom Schwaben, der das Leberlein gefressen“, ist ein märchenhaft anmutender Text, der stark von komischen und moralischen Elementen geprägt ist. Eine linguistische Analyse dieses Textes würde verschiedene Aspekte untersuchen:
Sprachliche Merkmale
Archaische Sprachformen: Der Text verwendet ältere, teils altertümliche deutsche Sprachformen, die typisch für die Zeit und das Genre sind. Beispiele sind Begriffe wie „Leiden-Gesell“ oder „henket“, die in der modernen deutschen Sprache so nicht mehr gebräuchlich sind.
Dialektale Einflüsse: Der Begriff „Schwab“ verweist auf den Charakter als Schwaben, was auch stereotype Vorstellungen vom Schwaben in der deutschen Folklore hervorrufen kann. Der Dialekt oder die Herkunft prägt den Charakter oft als simpel oder naiv.
Narrative Struktur
Dialogorientierung: Die Geschichte wird stark durch Dialoge vorangetrieben. Der Schwab interagiert direkt mit einer personifizierten göttlichen Figur, was Hinweise auf die moralische Dimension dieser Interaktionen gibt.
Wiederholungen: Die Erzählung nutzt übertriebene Wiederholungen und Parallelstrukturen, um den komischen Effekt zu verstärken. Der Schwabe wiederholt seine Fehler und Missverständnisse, was das humorvolle Element der Märchentradition unterstützt.
Thematische Elemente
Moral und Lehre: Wie viele Märchen enthält auch diese Erzählung eine moralische Lehre. Die vermeintliche Dummheit oder Schlitzohrigkeit des Schwaben sowie die Geduld und Güte der göttlichen Figur tragen zur Botschaft der Geschichte bei.
Göttliche und weltliche Werte: Der Kontrast zwischen den materiellen Bedürfnissen des Schwaben und der spirituellen Mission der göttlichen Figur ist zentral. Die Geschichte thematisiert den Konflikt zwischen geistigen und weltlichen Belangen.
Intertextuelle Bezüge
Biblische Anspielungen: Die Präsenz einer Jesus-ähnlichen Figur und die Referenzen zur christlichen Lehre („im Namen des Vaters, Sohnes und Heiligen Geistes“) verleihen dem Text eine intertextuelle Ebene, die die religiöse Bildung und das kulturelle Bewusstsein des Lesers anspricht.
Diese verschiedenen Aspekte zeigen, wie der Text sowohl komisch als auch didaktisch funktioniert, indem er traditionelle narrative Techniken mit einer Pointierung auf kulturellen und moralischen Werten kombiniert. Der humorvolle Umgang mit ernsthaften Themen ist ein typisches Merkmal vieler Volksmärchen und bietet einen Einblick in die gesellschaftlichen Einstellungen und Werte der Zeit.
Informationen für wissenschaftliche Analysen
Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Lesbarkeitsindex nach Amstad | 87.3 |
| Lesbarkeitsindex nach Björnsson | 23.3 |
| Flesch-Reading-Ease Index | 76.9 |
| Flesch–Kincaid Grade-Level | 4.9 |
| Gunning Fog Index | 5.5 |
| Coleman–Liau Index | 10.2 |
| SMOG Index | 8 |
| Automated Readability Index | 4.1 |
| Zeichen-Anzahl | 2.581 |
| Anzahl der Buchstaben | 2.023 |
| Anzahl der Sätze | 48 |
| Wortanzahl | 458 |
| Durchschnittliche Wörter pro Satz | 9,54 |
| Wörter mit mehr als 6 Buchstaben | 63 |
| Prozentualer Anteil von langen Wörtern | 13.8% |
| Silben gesamt | 651 |
| Durchschnittliche Silben pro Wort | 1,42 |
| Wörter mit drei Silben | 33 |
| Prozentualer Anteil von Wörtern mit drei Silben | 7.2% |
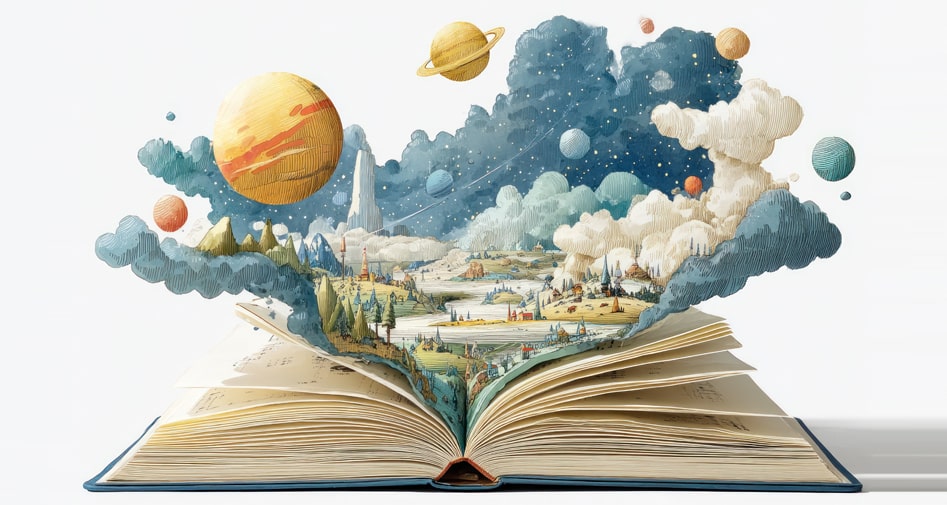
 Facebook
Facebook  Whatsapp
Whatsapp  Messenger
Messenger  Telegram
Telegram














