Vorlesezeit: 9 min
In einer Stadt saß ein Mann, der hatte alle Kisten voll Geld und Gut, er selbst aber war voll aller Laster, so schlimm war er, dass es die Leute schier Wunders dünkte, dass ihn die Erde nicht verschlang. Dieser Mann war noch dazu ein Richter, das heißt ein Richter, der aller Ungerechtigkeit voll war. An einem Markttage ritt er des Morgens aus, seinen schönen Weingarten zu sehen, da trat der Teufel auf dem Heimweg ihn an, in reichen Kleidern und wie ein gar vornehmer Herr gestaltet. Da der Richter nicht wusste, wer dieser Fremdling war, und solches doch gern wissen mochte, so fragte er ihn nicht eben höflich, wer und von wannen er sei. Der Teufel antwortete: »Euch ist besser, wenn Ihr’s nicht wisset, wer und woher ich bin!«
»Hoho!« fuhr der Richter heraus, »seid wer Ihr wollt, so muss ich’s wissen, oder Ihr seid verloren, denn ich bin der Mann, der hier Gewalt hat, und wenn ich Euch dies und das zu Leide tue, so ist niemand, der es mir wehren wird und kann. Ich nehme Euch Leib und Gut, wenn Ihr mir nicht auf meine Frage Bescheid gebt!«
»Steht es so schlimm«, antwortete der Arge, »so muss ich Euch wohl meinen Namen und mein Gekommen offenbaren; ich bin der Teufel.«
»Hm!« brummte der Richter, »und was ist hier deines Gewerbes, das will ich auch wissen?«
»Schau, Herr Richter«, antwortete der Böse, »mir ist Macht gegeben, heute in diese Stadt zu gehen und das zu nehmen, was mir in vollem Ernst gegeben wird.«
»Wohlan!« versetzte der Richter, »tue also, aber lass mich dessen Zeuge sein, dass ich sehe, was man dir geben wird!«
»Fordre das nicht, dabei zu sein, wenn ich nehme, was mir beschieden wird«, widerriet der Teufel dem Richter; dieser aber hub an, den Fürsten der Hölle mit mächtigen Bannworten zu beschwören, und sprach: »Ich gebiete und befehle dir bei Gott und allen Gottes Geboten, bei Gottes Gewalt und Gottes Zorn, und bei allem, was dich und deine Genossen bindet, und bei dem ewigen Gerichte Gottes, dass du vor meinem Angesicht, und anders nicht, nehmest, was man dir ernstlich geben wird.«
Der Teufel erschrak, dass er zitterte bei diesen fürchterlichen Worten, und machte ein ganz verdrießliches Gesicht, sprach auch: »Ei, so wollte ich, dass ich das Leben nicht hätte! Du bindest mich mit einem so starken Band, dass ich kaum jemals in größerer Klemme war. Ich gebe dir aber mein Wort als Fürst der Hölle, das ich als solcher niemals breche, dass es dir nicht zum Frommen dient, wenn du auf deinem Sinn bestehst. Stehe ab davon!«
»Nein, ich stehe nicht ab davon!« rief der Richter. »Was mir auch darum geschehe, das muss ich über mich ergehen lassen; ich will jenes nun einmal sehen! Und sollt es mir an das Leben gehen!«
Nun gingen beide, der Richter und der Teufel, miteinander auf den Markt, wo gerade Markttag war, daher viel Volks versammelt, und überall bot man dem Richter und seinem Begleiter, von dem niemand wusste, wer er sei, volle Becher und hieß sie Bescheid tun. Der Richter tat das auch nach seiner Gewohnheit und reichte auch dem Teufel eine Kanne, dieser aber nahm den Trunk nicht an, weil er wohl wusste, dass es des Richters Ernst nicht war.
Nun geschah es von ungefähr, dass eine Frau ein Schwein daher trieb, welches nicht nach ihrem Willen ging, sondern die Kreuz die Quere, da schrie die zornige Frau im höchsten Ärger dem Schwein zu: »Ei, so geh zum Teufel, dass dich der mit Haut und Haar hole!«
»Hörst du, Geselle?« rief der Richter dem Teufel zu. »Jetzt greife hin und nimm das Schwein.« Aber der Teufel antwortete: »Es ist leider der Frau nicht Ernst mit ihrem Wort. Sie würde ein ganzes Jahr lang trauern und sich grämen, nähme ich ihr das Schwein. Nur was mir im Ernste gegeben wird, das darf ich nehmen.«
Ähnliches geschah bald hernach mit einer Frau und einem Kind. Das letztere ging auch nicht so, wie die Frau es lenken wollte, so dass sie auch zu schreien begann: »Hole dich der Teufel, und drehe dir den Hals um!«
»Hörst du, Geselle?« fragte da wieder der Richter. »Das Kind ist dein, hörst du nicht, dass man es dir ernstlich gibt?«
»O nein, es ist auch nicht ihr Ernst!« antwortete der Teufel. »Sie würde bitterlich wehklagen, nähme ich sie beim Wort, und das Kind nicht fahren lassen.«
Jetzt sahen beide eine Frau, die hatte viel mit einem Kinde zu schaffen, welches heftig schrie und sich sehr unartig gebärdete, so dass die Frau voll Unwillens war und ausrief: »Willst du mir nicht folgen, so nehme dich der böse Feind, du Balg!«
»Nun, nimmst du auch nicht das Kind?« fragte der Richter ganz verwundert, und der Teufel antwortete: »Ich habe des keine Macht, das Kindlein zu nehmen. Diese Frau nähme nicht zehn, nicht hundert und nicht tausend Pfund und gönnte mir im Ernst das Kind; wie gern ich’s auch nähme, darf ich doch nicht, denn es ist nicht der Frau rechter Ernst.«
Nun kamen die beiden recht mitten auf den Markt, wo das dichteste Volksgedränge war, da mussten sie ein wenig stille stehen und konnten nicht durch das Gewimmel und Getümmel schreiten. Da wurde eine Frau des Richters ansichtig, die war arm und alt und krank und trug ein großes Ungemach; sie begann laut zu weinen und zu schreien und ließ vor allem Volk folgende heftige Rede vernehmen: »Weh über dich, Richter! Weh über dich, dass du so reich bist und ich so arm bin; du hast mir ohne Schuld, göttliche und menschliche Barmherzigkeit verleugnend, mein einziges Kühlein genommen, das mich ernährte, von dem ich meinen ganzen Unterhalt hatte. Weh über dich, der du es mir genommen hast! Ich flehe und schreie zu Gott, dass er durch seinen Tod und bitteres Leiden, die er für die Menschheit und für uns arme Sünder trug, meine Bitte gewähre, und die ist, dass deinen Leib und deine Seele der Teufel zur Hölle führe!«
Auf diese Rede tat der Richter weder Sage noch Frage, aber der Teufel fuhr ihn höhnisch an und sprach: »Siehst du, Richter, das ist Ernst, und den sollst du gleich gewahr werden!« Damit streckte der Teufel seine Krallen aus, nahm den Richter beim Schopf und fuhr mit ihm durch die Lüfte von dannen, wie der Geier mit einem Huhn. Alles Volk erschrak und staunte, und weise Männer sprachen die Lehre aus:
»Es ist ein unweiser Rat,
Der mit dem Teufel umgaht.
Wer gern mit ihm umfährt,
Dem wird ein böser Lohn beschert.«
 Lerne Sprachen. Doppelklick auf ein Wort.Lerne Sprachen im Kontext mit Childstories.org und Deepl.com.
Lerne Sprachen. Doppelklick auf ein Wort.Lerne Sprachen im Kontext mit Childstories.org und Deepl.com.Hintergründe
Interpretationen
Analyse
„Der Richter und der Teufel“ von Ludwig Bechstein ist ein Märchen, das sich mit den Themen Gerechtigkeit, Machtmissbrauch und den Konsequenzen des Handelns auseinandersetzt. Es erzählt die Geschichte eines ungerechten Richters, der durch sein verantwortungsloses Verhalten gegenüber seinen Mitmenschen in Schwierigkeiten gerät.
Moralische Lehren: Das Märchen vermittelt mehrere moralische Botschaften:
–
Gerechtigkeit und Unrecht: Der Richter steht als Symbol für Ungerechtigkeit, da er seine Macht missbraucht und zu seinem eigenen Vorteil handelt. Die Geschichte zeigt, dass solche Handlungen letztendlich bestraft werden.
Ernsthaftigkeit und Absicht: Der Teufel hebt hervor, dass er nur das nehmen kann, was ihm im vollen Ernst gegeben wird. Dies zeigt die Wichtigkeit der Ernsthaftigkeit und Konsequenz in den Worten und Taten der Menschen.
Göttliche Gerechtigkeit: Die Bestrafung des Richters kann als Manifestation göttlicher Gerechtigkeit verstanden werden, die letztlich über menschliche Ungerechtigkeit triumphiert.
Charaktere und Symbole
Der Richter: Verkörpert Machtmissbrauch und moralisches Fehlverhalten. Er ist reich an irdischen Gütern, aber arm an Tugend und Empathie.
Der Teufel: Funktioniert als Katalysator für die Geschichte und ermöglicht die Darstellung der Konsequenzen des Handelns. Er erscheint höflich und geduldig, was untypisch für das klassische Bild des Teufels ist, wodurch Bechstein die Vielschichtigkeit des Bösen betont.
Die alte Frau: Sie stellt die Stimme der Gerechtigkeit dar. Ihre Klage wird vom Teufel ernst genommen, was letztlich zur Bestrafung des Richters führt.
Struktur und Stil: Das Märchen folgt einer klassischen Struktur mit einem klaren moralischen Konflikt, einer Konfrontation und einer Auflösung, die die Ausgangssituation drastisch verändert. Bechsteins Sprache ist schlicht, doch eindrücklich, geeignet, moralische Belehrungen zugänglich und einprägsam zu gestalten.
Zeitgenössischer Kontext: In der Zeit, als Bechstein lebte (19. Jahrhundert), herrschte in vielen Teilen Europas Unsicherheit über die gesellschaftlichen und rechtlichen Systeme. Märchen wie dieses reflektierten und kritisierten oft Missstände, indem sie extreme Beispiele für Ungerechtigkeit und Korruption aufzeigten.
„Der Richter und der Teufel“ bleibt ein mahnendes Beispiel, wie Macht nicht nur Verantwortung, sondern auch Rechenschaftspflicht bedeutet, und dass letztlich kein Unrecht ungestraft bleibt.
Die Erzählung „Der Richter und der Teufel“ von Ludwig Bechstein ist ein klassisches Märchen, das die Thematik von Gier, Ungerechtigkeit und den Konsequenzen unmoralischen Verhaltens behandelt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Geschichte zu interpretieren.
Moralische Lektion: Die Geschichte lehrt, dass gieriges und ungerechtes Verhalten letztendlich bestraft wird. Der Richter ist ein Symbol für Korruption und Machtmissbrauch. Seine Ungerechtigkeit und sein Mangel an Mitgefühl führen schließlich zu seinem Untergang. Diese Interpretation unterstreicht die moralische Botschaft, dass Böses nicht ungestraft bleibt.
Warnung vor Hochmut: Der Richter zeigt einen gewissen Hochmut in seinem Umgang mit dem Teufel. Seine Arroganz und sein Glaube, er könne den Teufel überlisten, führen zu seiner eigenen Zerstörung. Diese Interpretation fokussiert auf die Idee, dass Überheblichkeit und das Ignorieren von Warnungen schwere Konsequenzen haben können.
Die Macht der Ernsthaftigkeit im Wort: In dem Märchen wird die Idee untersucht, dass nur ernsthaft gemeinte Worte Macht haben. Der Teufel kann nur das nehmen, was ihm ernsthaft gegeben wird. Diese Interpretation könnte auf die Bedeutung von wahrhaftigem und ernsthaftem Sprechen hinweisen und die Verantwortung, die mit Worten einhergeht.
Symbolik von Gut und Böse: Der Richter verkörpert das Böse in der Welt durch seine korrupten Taten, während der Teufel, trotz seiner Rolle als Gegenspieler, eine Art Gerechtigkeitsbringer wird, indem er den Richter bestraft. Diese Interpretation könnte die Idee von karmischer Gerechtigkeit oder dem unausweichlichen Ausgleich von Gut und Böse darstellen.
Kritik an sozialer Ungerechtigkeit: Die Geschichte thematisiert soziale Ungleichheit und Ungerechtigkeit durch den Gegensatz zwischen dem reichen, bösen Richter und der armen, leidenden Frau. Diese Perspektive könnte die Kritik an einer ungleichen Gesellschaft und an der Ausnutzung von Macht durch die Oberen in der Gesellschaft reflektieren.
Insgesamt ist „Der Richter und der Teufel“ eine tiefgründige Geschichte mit mehreren Ebenen der Interpretation, die über oberflächliche Märchenmotive hinausgeht und grundlegende menschliche und gesellschaftliche Themen behandelt.
„Linguistische Analyse des Märchens ‚Der Richter und der Teufel‘ von Ludwig Bechstein“
1.
Einführung:
Das vorliegende Märchen „Der Richter und der Teufel“ von Ludwig Bechstein ist ein Beispiel für die deutsche Märchenliteratur des 19. Jahrhunderts. Bechstein, ein Zeitgenosse der Brüder Grimm, verfasste zahlreiche Märchen und Sagen, die sich durch ihre moralischen Botschaften und ihre besondere Sprache auszeichnen.
2.
Sprachliche Merkmale:
a.
Wortwahl und Lexikon:
Das Märchen verwendet eine Vielzahl von archaischen und formellen Ausdrücken, die charakteristisch für die Sprachweise des 19. Jahrhunderts sind. Wörter wie „Wunders dünkte“, „gerecht“ und „ergreifen“ sind Belege für diese ältere Sprachebene. Zudem finden sich zahlreiche Ausdrücke, die eher in der mündlichen Überlieferung von Geschichten verbreitet sind, etwa „in vollem Ernst“ oder „auf meinem Sinn bestehst“.
b.
Syntax:
Die Satzstruktur in Bechsteins Märchen ist oft komplex und weist lange, verschachtelte Sätze auf. Dies kann an Sätzen wie „Der Teufel erschrak, dass er zitterte bei diesen fürchterlichen Worten, und machte ein ganz verdrießliches Gesicht, sprach auch: ‚Ei, so wollte ich, dass ich das Leben nicht hätte!’“ beobachtet werden. Diese Art der Syntax ist typisch für die Schriftwerke des 19. Jahrhunderts und spiegelt die Erzähltradition wider.
c.
Direkte Rede und Dialoge:
Das Märchen nutzt umfangreiche Dialoge, um die Handlung voranzutreiben und die Charaktere zu entwickeln. Die direkte Rede verleiht der Geschichte Dynamik und beleuchtet die unterschiedlichen Persönlichkeiten des Richters und des Teufels. Die Rede des Teufels ist charismatisch und oft sarkastisch, während der Richter dominant und fordernd auftritt.
d.
Stilmittel:
Bechstein nutzt in diesem Märchen verschiedene stilistische Mittel, darunter:
–
Wiederholungen: Wiederholte Wendungen und Satzstrukturen dienen der Betonung und Verstärkung der moralischen Aussagen. Beispielsweise wird häufig die Ernsthaftigkeit des Wunsches oder der Aussage geprüft.
Metaphern und Vergleiche: Diese kommen vor, um die Schwere der Situation und die Charaktere zu verdeutlichen, wie beim Vergleich des Teufels, der den Richter „wie der Geier mit einem Huhn“ davonträgt.
3.
Thematische Analyse:
Das Hauptthema des Märchens ist die göttliche Gerechtigkeit und Moral. Der Richter, der sein Amt missbraucht und ungerecht handelt, wird am Ende durch den Teufel bestraft. Dies spiegelt die moralischen Lehren wider, die in Märchen oft zu finden sind: Das Böse wird letztlich vergolten, und göttliche oder übernatürliche Mächte sorgen für Gerechtigkeit. Die Warnung am Ende des Märchens weist auch auf die Gefahren hin, sich mit dunklen Mächten einzulassen.
4.
Historischer Kontext und Rezeption:
Bechsteins Märchen sind im kulturellen und sozialen Kontext des 19. Jahrhunderts verankert. Sie bedienen sich der volkstümlichen Moralerzählung und spiegeln die Werte der Zeit wider. Der Einfluss der Romantik ist im Hang zu mystischen und übernatürlichen Elementen erkennbar. Bechstein war weniger als Volkskundler denn als Märchensammler bekannt und steht oft im Schatten der Brüder Grimm, obwohl seine Werke zu ihrer Zeit weit verbreitet waren.
5.
Schlussfolgerung:
Das Märchen „Der Richter und der Teufel“ ist ein faszinierendes Beispiel für die sprachliche und thematische Gestaltung der Märchen im 19. Jahrhundert. Es zeigt die Fähigkeiten Bechsteins, durch eine meisterhafte Verwendung der Sprache und der straffen Erzählstruktur eine wirkungsvolle moralische Geschichte zu präsentieren.
Informationen für wissenschaftliche Analysen
Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Lesbarkeitsindex nach Amstad | 85.6 |
| Lesbarkeitsindex nach Björnsson | 28.1 |
| Flesch-Reading-Ease Index | 77.3 |
| Flesch–Kincaid Grade-Level | 6.5 |
| Gunning Fog Index | 7.7 |
| Coleman–Liau Index | 9.6 |
| SMOG Index | 8.3 |
| Automated Readability Index | 6.9 |
| Zeichen-Anzahl | 3.874 |
| Anzahl der Buchstaben | 3.029 |
| Anzahl der Sätze | 44 |
| Wortanzahl | 703 |
| Durchschnittliche Wörter pro Satz | 15,98 |
| Wörter mit mehr als 6 Buchstaben | 85 |
| Prozentualer Anteil von langen Wörtern | 12.1% |
| Silben gesamt | 942 |
| Durchschnittliche Silben pro Wort | 1,34 |
| Wörter mit drei Silben | 34 |
| Prozentualer Anteil von Wörtern mit drei Silben | 4.8% |
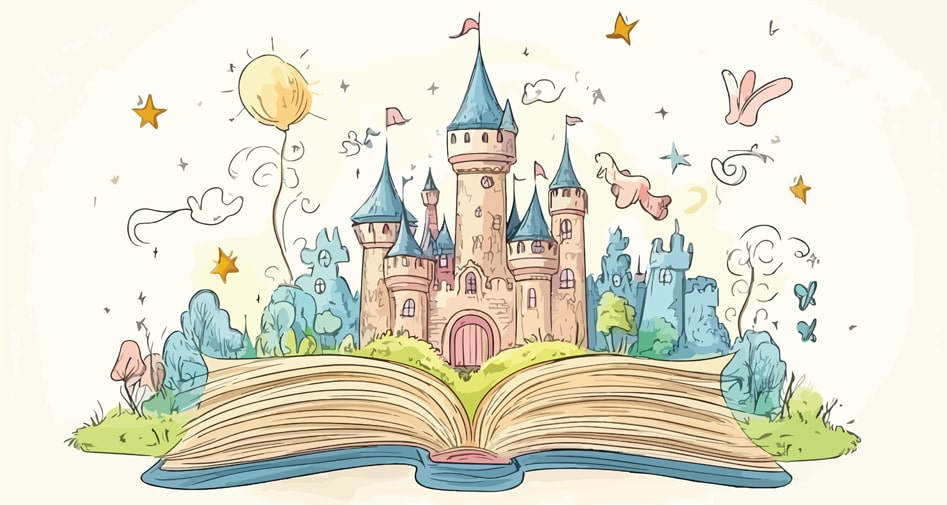
 Facebook
Facebook  Whatsapp
Whatsapp  Messenger
Messenger  Telegram
Telegram














