Vorlesezeit: 8 min
Auf hohem Alpengebirge lag eine große blühende Stadt, umgeben von hochragenden Bergzackenhörnern, die ewiger Schnee bedeckte, die Stadt aber lag auf einer weithingebreiteten sonnigen Matte, auf welcher zahlloses Vieh weidete, denn das Volk, das jene Alpenstadt bewohnte, war ein Hirtenvolk, das fast ganz abgesondert lebte von den Bewohnern der tieferen Gegenden. Selten zog ein Wanderer oder ein Saumross die Gebirgspfade, die über jene Hochalpen hinweg nach Welschland führten, selten sahen die Bewohner jener Gebirgsstadt einen Fremdling.
Eines Tages aber sahen sie einen fremden Wanderer durch ihren Ort schreiten, eine hohe ernste Gestalt; sein Gesicht war bräunlich von Farbe, aber bleich, mit langem Barte, sein Haar schwarz mit grau gemischt, sein Gewand ein langer brauner Talar, mit einem Stück umgürtet, seine Fußbekleidung starke Schuhe, mit Riemen um die Knöchel befestigt. Müde schien der Mann und der Ruhe sehr bedürftig, aber er trug einen Fluch, dass er sich nicht setzen und weilen durfte, bevor ihn jemand sitzen und verweilen hieß. Die Bewohner der Hochgebirgsstadt sahen den fremden Mann mit einer eigenen Scheu an, und er flößte ihnen ein seltsames Grauen ein. Und der Mann ging von Haus zu Haus und stand vor jeder Türe und harrte, dass jemand zu ihm sage: »Sitze nieder und raste« – aber niemand sprach solche Worte, wohl aber sammelte sich des Volkes mehr und mehr und gaffte ihn neugierdevoll an. Und der müde Mann stand und seufzte.
Da trat der Stadtälteste heran, der zugleich ein Priester war, der sprach zu ihm: »Höre, du fremder Mann, wer du bist, das wissen wir und sehen es dir an. Du bist kein anderer als der ewige Jude. Du bist verdammt, zu wandern ewiglich, weil du den Heiland der Welt auf seinem Gange zum bittern Kreuzestode die kurze Ruhe auf der Steinbank vor deinem Hause zu Jerusalem versagt hast – darum so hebe dich von hinnen aus unserer Stadt, denn du kannst allda nicht weilen und darfst nicht weilen, und wir können und dürfen dich nicht hegen und beherbergen, zu unserem eigenen Leid. Gehe mit Gott!«
Da öffnete der ewige Jude seine bleichen Lippen und sprach: »Ich werde gehen jetzt und ihr bleibt, ihr aber werdet vergehen, und ich werde bleiben. Wann ich werde wiederkommen an diesen Ort, so werde ich hier finden zwar eine Stätte, aber keine Stadt – und wann ich werde kommen zum dritten Male, so werde ich auch nicht mehr finden die Stätte, da eure Stadt gestanden hat.«
Alle, die das Wort hörten, erschraken und traten scheu zur Seite, als der finstere Mann seinen Stab schüttelte und durch ihre gedrängten Reihen schritt und müden Ganges aus dem Orte wanderte, hoch hinauf in das unwirtbare Gebirge. Keiner von allen sah in wieder.
Seit diesem Tage wurde kein neues Haus mehr errichtet in jener Stadt – keine Herde mehrte sich – kein Kindlein wurde geboren – manches Haus starb bald aus – nach einer Reihe von Jahren standen viele Häuser ganz leer und verfielen.
Von den Bergen stürzten Lawinen herab und zerschmetterten die Häuser. Bergstürze ereigneten sich, und mächtige Felsblöcke lagen jetzt da, wo früher in den Straßen der Stadt ein reges fröhliches Leben war. Die große Stadt war noch fünfzig Jahr ein Alpendorf mit weit und zerstreut voneinander liegenden Häusern, mit dürftiger Nahrung, magern Herden, siechen Bewohnern. Sie kamen nicht mehr herab zu den tiefer gelegenen Ortschaften, und niemand stieg aus letzteren zu ihnen hinauf – und so wurde endlich alles droben wüst und leer – und über die letzten Toten wölbte sich kein Grabeshügel, sondern die brechenden Häuser begruben sie unter Trümmern, dann begruben Steinrutschen, welche im Alpenlande Muren heißen, wiederum jene Trümmer, oder Schlammbäche von den Berggipfeln quollen nieder und deckten alles zu.
Nach hundert Jahren kam der Wanderer wieder; an der Lage der Bergrücken umher erkannte er die Stätte, hohe Bäume waren gewachsen aus den Trümmern, hie und da stand noch ein Mauerrest, man konnte aber nicht mehr recht unterscheiden, ob es Felsen waren oder Werke von Menschenhand. Mächtige Sträucher mit bunten Alpenblumen waren da emporgeschossen, wo vor dessen Straße war, und Gras stand da, wo sonst der Menschen friedliche Wohnstätte gewesen.
Und der ewige Jude seufzte und sprach: »Was hat gesungen einst David, der König über Israel? Er hat gesungen: ›Wenn Du nach des Gottlosen Stätte sehen wirst, wird er weg sein.‹«
Und hob den Fuß und wandelte wieder rast- und ruhelos über das Hochgebirge.
Und die Stätte jener Stadt blieb nicht dieselbe, wie sie gewesen, sie wurde immer öder, kahler, schauriger, doch ganz allmählich und so langsam, Jahr um Jahr. Die Alpensträucher gingen aus, das Gras verdorrte, es fiel in dieser hohen Bergregion kein Regen mehr hinweg, auch wenn die Sommersonne am höchsten stand. Die Quellen, die von den höheren Spitzen des Gebirges früher als reizende Wasserfälle nieder rauschten, gefroren und bildeten über sich Decken von grünlichem Eis; sie wurden zu Gletschern, und diese Gletscher wurden größer und größer und schoben sich über die einst so herrlich grünen sonnigen Matten mehr und mehr und bedeckten sie ganz.
Als der ruhelose Wanderer, nachdem abermals hundert Jahre vergangen waren, wieder hinauf kam auf das Gebirge, da fand und erkannte er die Stätte nicht mehr, auf welcher einst die blühende Stadt gestanden hatte, und tat seinen Mund auf und sprach: »Erfüllt ist nun das Wort des Herrn, das er tat durch den Mund des Propheten, seines Knechts: ›Ich will meine Hand über sie ausstrecken und das Land wüst und öde machen.‹«
 Lerne Sprachen. Doppelklick auf ein Wort.Lerne Sprachen im Kontext mit Childstories.org und Deepl.com.
Lerne Sprachen. Doppelklick auf ein Wort.Lerne Sprachen im Kontext mit Childstories.org und Deepl.com.Hintergründe
Interpretationen
Analyse
„Die verwünschte Stadt“ von Ludwig Bechstein ist ein Märchen, das tief in mythologischen und religiösen Motiven verwurzelt ist. Die Geschichte handelt von einem mysteriösen Wanderer, der als der „ewige Jude“ identifiziert wird, eine Figur aus der christlichen Folklore. Diese Figur ist dazu verdammt, ruhelos auf der Erde zu wandern, weil sie Jesus Christus auf dem Weg zur Kreuzigung angeblich keine Ruhe gewährt hat.
Das Märchen spielt in einer idyllischen Stadt in den Alpen, die weitgehend von der Außenwelt isoliert ist. Die Ankunft des ewigen Juden bringt eine düstere Prophezeiung mit sich, die den Verfall und das Verschwinden der Stadt ankündigt. Obwohl die Warnungen und Flüche oft eher symbolisch als wörtlich zu verstehen sind, entfalten sie hier ihre volle zerstörerische Kraft.
Die Erzählung greift mehrere traditionelle Themen und Motive auf. Die Isolation der Stadt symbolisiert eine Art von Selbstgenügsamkeit und Ignoranz gegenüber dem Unheil in der Welt. Die Gestalt des ewigen Juden fungiert als Mahner der Vergänglichkeit menschlichen Strebens und der Konsequenzen mangelhafter Nächstenliebe. Seine Prophezeiung löst einen unaufhaltsamen Verfall aus, der durch das Versagen der Bewohner, einem in Not geratenen Individuum zu helfen, initiiert wird.
Die Allmählichkeit der Zerstörung der Stadt – vom blühenden Ort zum Gletscher überzogenen Ödland – spiegelt den Verlust von Menschlichkeit und Mitgefühl wider, ein zentraler Bestandteil der Lehre, die das Märchen übermittelt. Die Metamorphose der einst lebendigen Stadt zu einer kargen, verlassenen Eiswüste verstärkt den Eindruck der Unausweichlichkeit des Schicksals und der Beständigkeit der göttlichen Gerechtigkeit, wie sie im biblischen Kontext verstanden wird.
Bechsteins Märchen verbindet das Unheimliche und das Mahnende mit einer klaren moralischen Botschaft über die Bedeutung von Empathie und den Folgen des Unterlassens guter Taten. Es zeigt die Wechselwirkungen zwischen Mensch und Natur und den langfristigen Einfluss menschlichen Handelns auf die Umwelt und die Gesellschaft.
Die Geschichte „Die verwünschte Stadt“ von Ludwig Bechstein bietet eine klassische Auseinandersetzung mit dem Motiv der vergänglichen menschlichen Zivilisation und dem ewigen Wanderer, verkörpert durch die Figur des „Ewigen Juden“. Diese Erzählung weckt verschiedene Interpretationen, die interessante Aspekte der menschlichen Natur und der Beziehung zwischen Mensch und Natur beleuchten.
Moralische Lektion: Eine Interpretation könnte die Geschichte als moralische Lektion über das Mitleid und die Gastfreundschaft ansehen. Die Bewohner der Stadt zeigen dem erschöpften Wanderer gegenüber keine Gastfreundschaft oder Mitgefühl. Diese fehlende Mitmenschlichkeit führt letztlich zum Untergang der Stadt. Es ist eine Warnung, dass die Vernachlässigung von Menschlichkeit zu Konsequenzen führen kann, die weitreichender sind als individuelles Leid.
Der Fluch des Ewigen Juden: Die Figur des Ewigen Juden ist seit Jahrhunderten ein Symbol für ewige Buße und Rastlosigkeit. In Bechsteins Geschichte bringt seine Präsenz Unglück über die Stadt, was als Metapher für die langen Schatten vergangener Taten gesehen werden kann. Die Unfähigkeit, aus der Geschichte zu lernen und Sühne zu leisten, führt zur unausweichlichen Bestrafung.
Vergänglichkeit und Natur: Die Geschichte könnte außerdem eine Reflexion über die Vergänglichkeit von Menschenwerken sein. Trotz ihrer ursprünglichen Blüte wird die Stadt letztlich von den Kräften der Natur überwältigt. Dies kann als Erinnerung daran verstanden werden, dass alle menschlichen Erfolge nur vorübergehende Eroberungen der Natur sind, die letztlich wieder in den Zustand der Wildnis zurückkehren.
Prophetie und Vorherbestimmung: Der Ewige Jude fungiert als eine Art prophetische Figur, die das Schicksal der Stadt vorhersagt. Die Unvermeidlichkeit dieser Prophezeiungen spiegelt die Themen Schicksal und Vorherbestimmung wider, die in vielen Märchen und Legenden vorkommen. Diese Erzählung regt zum Nachdenken darüber an, inwieweit das Schicksal durch individuelles Handeln beeinflusst werden kann.
Isolation und Wandel: Die Stadt ist von der Außenwelt isoliert und in ihrer Selbstgenügsamkeit gefangen. Diese Isolation könnte auch symbolisch für gesellschaftliche Stagnation stehen, die letztlich zum Verfall führt. Dies könnte als Kommentar darauf verstanden werden, dass Kulturen und Gemeinschaften, die sich nicht öffnen und mit der Außenwelt interagieren, irgendwann stagnieren und untergehen.
Letztlich kombiniert Bechsteins Erzählung klassische Märchenelemente mit tiefen menschlichen Fragen und bietet auf diese Weise verschiedene Lesarten, die über die oberflächliche Handlung hinaus auf komplexe thematische Überlegungen verweisen.
Die Erzählung „Die verwünschte Stadt“ von Ludwig Bechstein ist ein eindrucksvolles Beispiel für die Verflechtung von Mythos und Moral innerhalb der deutschen Märchenliteratur. In diesem Märchen wird der altbekannte Mythos des „Ewigen Juden“ aufgegriffen und mit einer moralischen Lehre über Vergänglichkeit und die Folgen von Unbarmherzigkeit verbunden. Im Folgenden werden einige zentrale Elemente dieser Erzählung linguistisch und thematisch beleuchtet:
Setting und Atmosphäre:
Das Märchen beginnt mit einer detaillierten Beschreibung der alpinen Landschaft, die eine faszinierende Kulisse für die Geschichte bildet. Durch die Verwendung von Adjektiven wie „hohem“, „blühend“ und „sonnigen“ wird zunächst eine idyllische, fast paradiesische Umgebung geschaffen, die den Kontrast zur späteren Verlassenheit und Zerstörung verstärkt. Die Sprache malt ein Bild von Abgeschiedenheit und Selbstgenügsamkeit der Stadt, die in Harmonie mit der umgebenden Natur steht.
Symbolik des Ewigen Wanderns:
Der „Ewige Jude“ ist ein Figurensymbol für die endlose Suche nach Ruhe und Erlösung. Bechstein beschreibt ihn mit einer gewissen Ehrfurcht einflößenden Gravitas: eine „hohe ernste Gestalt“ mit „langem Barte“ und „starkem Schuhe“. Diese Beschreibung verweist auf eine Figur, die von der Zeit und der Last ihrer Taten gezeichnet ist. Das Motiv des ewigen Wanderns wird durch den ununterbrochenen Bewegungsdrang und das Bedürfnis nach Rast weiter unterstrichen, was im Volksglauben oft als Strafe für begangene Sünden interpretiert wird.
Moral und transzendente Gerechtigkeit:
Die Weigerung der Stadtbewohner, dem Fremden Rast zu gewähren, wird letztlich zur Ursache ihrer eigenen Vernichtung. Die Prophezeiung des Wanderers fungiert als ein Metakommentar zur Idee der moralischen Gerechtigkeit, die über menschliche Zeitspannen hinaus reicht. Die progressive Verwüstung der Stadt, über die Jahrhunderte hinweg, spiegelt die alttestamentarische Vorstellung von göttlicher Vergeltung wider, wie sie durch Zitate aus den Psalmen und den Propheten thematisch verankert wird.
Zeit und Vergänglichkeit:
Eine faszinierende Komponente der Erzählung ist ihr Umgang mit Zeit. Anstelle schneller Konsequenzen entfaltet sich das Schicksal der Stadt über mehrere Jahrhunderte. Dies vermittelt einerseits die Unerbittlichkeit des Fluchs und andererseits die langsame, oft nicht unmittelbar sichtbare Realisierung von göttlicher Gerechtigkeit. Die detaillierte Beschreibung des Verfallsprozesses – vom „Alpendorf“ bis zur vollständigen Gletscherlandschaft – betont die Macht der Natur und die Vergänglichkeit menschlicher Schöpfungen.
Sprache und Stil:
Bechsteins Sprache ist geprägt von archaischen Wendungen („hebe dich von hinnen“, „geh mit Gott“), die dem Märchen einen feierlichen und zeitlosen Ton verleihen. Die syntaktische Struktur und der gewählte Wortschatz unterstützen die Erhabenheit der erzählten Ereignisse und verstärken die moralische Botschaft.
Insgesamt verwendet Bechstein die Erzählung nicht nur als unterhaltsame Geschichte, sondern as kontextualisierte Lehre über ethisches Verhalten und die unausweichliche Konsequenz göttlicher und natürlicher Ordnungen.
Informationen für wissenschaftliche Analysen
Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Lesbarkeitsindex nach Amstad | 59.6 |
| Lesbarkeitsindex nach Björnsson | 47.9 |
| Flesch-Reading-Ease Index | 45.1 |
| Flesch–Kincaid Grade-Level | 12 |
| Gunning Fog Index | 14.4 |
| Coleman–Liau Index | 12 |
| SMOG Index | 12 |
| Automated Readability Index | 12 |
| Zeichen-Anzahl | 2.436 |
| Anzahl der Buchstaben | 1.965 |
| Anzahl der Sätze | 14 |
| Wortanzahl | 402 |
| Durchschnittliche Wörter pro Satz | 28,71 |
| Wörter mit mehr als 6 Buchstaben | 77 |
| Prozentualer Anteil von langen Wörtern | 19.2% |
| Silben gesamt | 630 |
| Durchschnittliche Silben pro Wort | 1,57 |
| Wörter mit drei Silben | 49 |
| Prozentualer Anteil von Wörtern mit drei Silben | 12.2% |
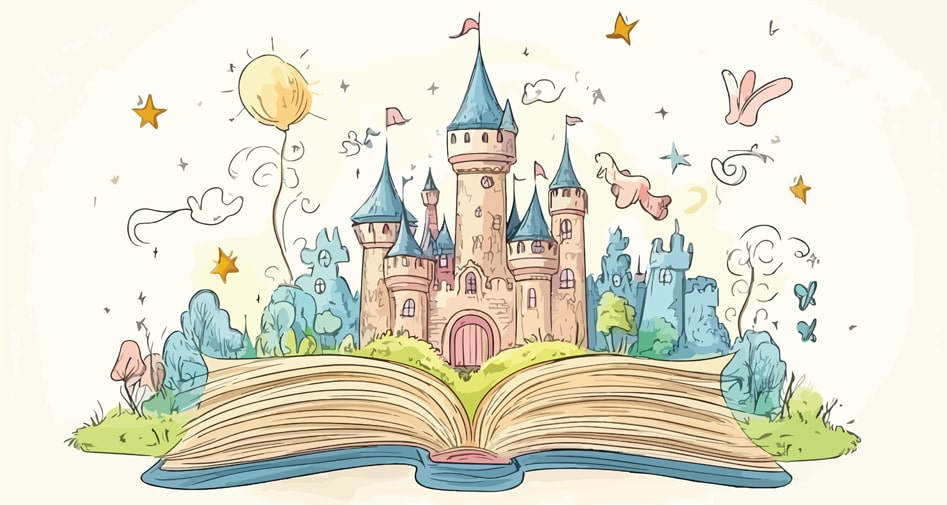
 Facebook
Facebook  Whatsapp
Whatsapp  Messenger
Messenger  Telegram
Telegram















